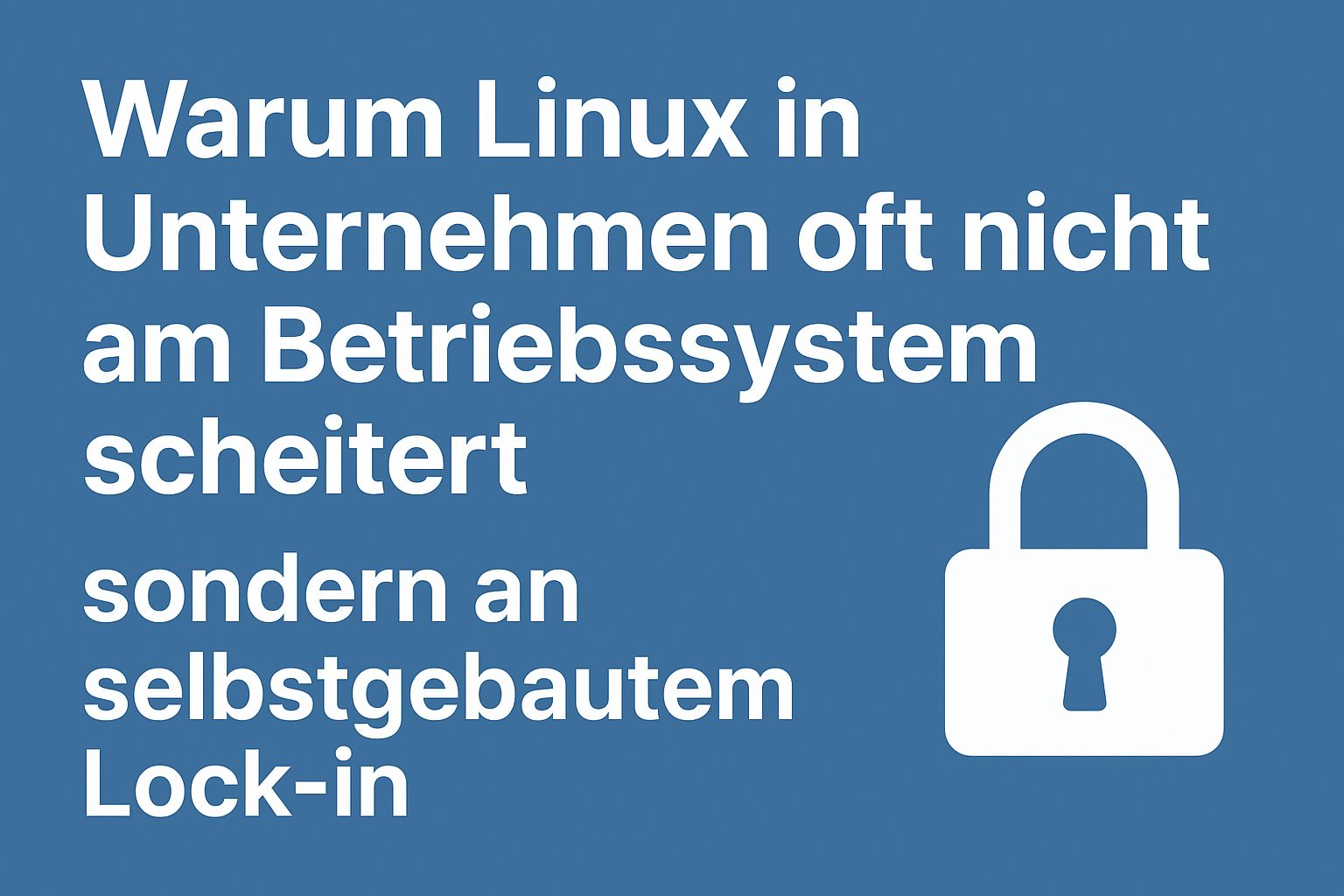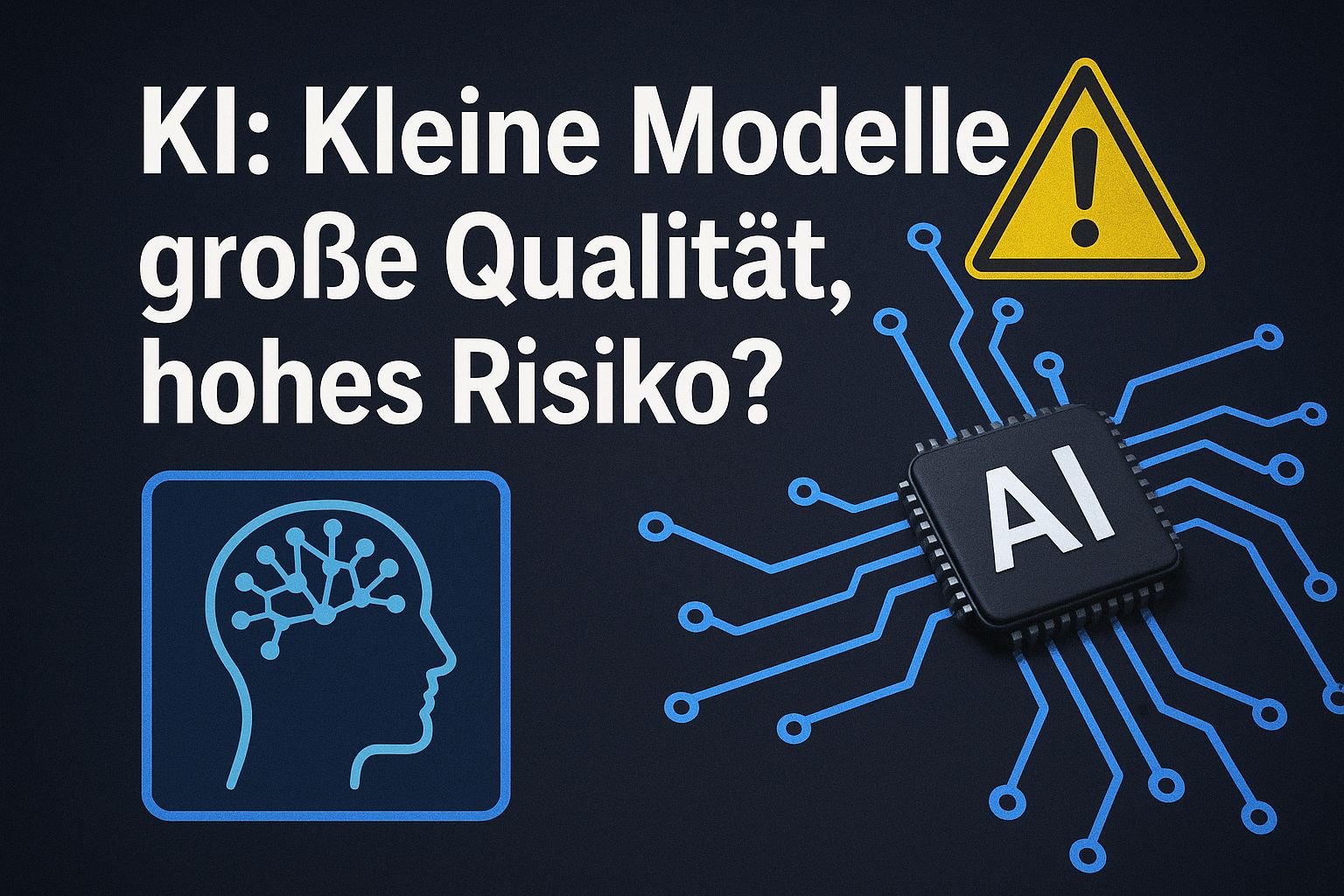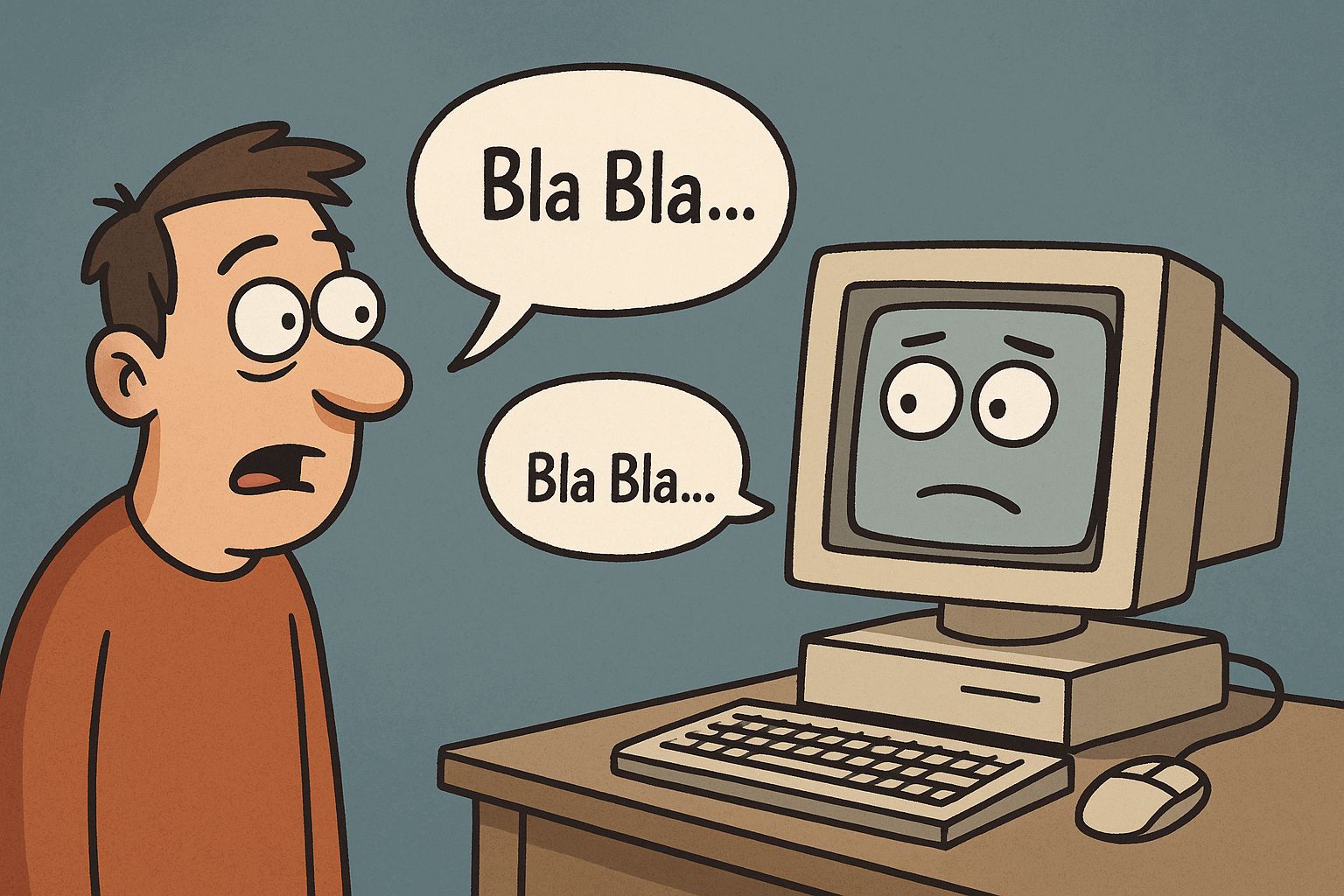Veraltete, Microsoft-zentrierte Mindsets in Projekten – ein Problem, das wir endlich benennen sollten

In vielen Projekten begegnet man ihnen noch immer: Word-Dokumenten und Excel-Sheets als zentrales Projektmanagement-Instrument. Oft mit dem Argument verteidigt, dass diese Dateien ja inzwischen in OneDrive liegen, geteilt werden können und damit „modern“ seien. Doch machen geteilte Word-Dokumente ein Projekt wirklich zeitgemäß? Kurz gesagt: nein.
Geteilt heißt nicht strukturiert
Nur weil Word-Dokumente und Excel-Sheets in der Cloud liegen, sind sie noch lange kein modernes Projektmanagement-System. Eine Sammlung von Dateien bleibt eine Sammlung von Dateien – schwer durchsuchbar, schlecht strukturiert und kaum skalierbar. Wer jemals versucht hat, in dutzenden Word-Dokumenten die relevante Information zu finden, weiß, wie ineffizient das ist.
Unübersichtliche Verzeichnisstrukturen verschärfen das Problem zusätzlich. Was in Dateiordnern schnell im Chaos endet, ist in Confluence klar strukturiert: Seitenhierarchien, automatisch aktualisierte Inhaltsverzeichnisse und konsistente Navigation sorgen dafür, dass Wissen auffindbar bleibt – ohne dass bei jeder strukturellen Änderung mehrere Dokumente manuell angepasst werden müssen.
Wissen vernetzen statt Dateien verlinken
Auch das Verlinken zwischen Word-Dokumenten und Excel-Sheets ist in der Praxis umständlich und fehleranfällig. Links brechen, Pfade ändern sich, Versionen driften auseinander. Moderne Wissens- und Projekttools setzen hier an einem anderen Punkt an: Inhalte sind direkt miteinander verknüpft, kontextualisiert und immer aktuell.
Confluence ist kein „besseres Word“, sondern ein Wissenssystem. Jira ist kein „buntes Excel“, sondern ein Projekt- und Prozesswerkzeug mit eingebauter Logik.
Excel ersetzt kein Jira-Board
Ein paar Hintergrundfarben und Filter in Excel machen noch kein Sprint-Board. Jira bringt Scrum- und Kanban-Logik von Haus aus mit: Backlogs, Sprints, Workflows, Abhängigkeiten, Reports. Wer Einträge manuell von einem Excel-Sheet ins nächste kopiert, um Sprints nachzubilden, arbeitet gegen das Tool – und gegen das Projekt.
Das kostet nicht nur Zeit, sondern verhindert Transparenz, Nachvollziehbarkeit und saubere Prozesse.
Eine Frage der Haltung – nicht der Tools
Wer sich heute aktiv weigert, etablierte Tools wie Confluence und Jira zu nutzen, und stattdessen auf lose Sammlungen von Word-Dokumenten und Excel-Sheets setzt, sollte sich ehrlich fragen, ob dieses Mindset noch zur eigenen Rolle passt. Projektarbeit bedeutet Zusammenarbeit, Transparenz und kontinuierliche Verbesserung – nicht das Festhalten an Arbeitsweisen aus den frühen 2000ern.
Gleiches gilt für Teammitglieder, die sich im Projekt konsequent gegen die vereinbarten Tools sperren. Tool-Disziplin ist keine Schikane, sondern eine Voraussetzung für effiziente Zusammenarbeit.
Fazit
Moderne Projekte brauchen moderne Werkzeuge – und vor allem moderne Denkweisen. Microsoft Word und Excel haben ihren Platz, aber nicht als Ersatz für professionelle Projekt- und Wissensmanagement-Systeme. Wer Projekte erfolgreich führen will, sollte nicht nur Prozesse modernisieren, sondern auch alte, bequem gewordene Mindsets hinterfragen.
 bezahlt von
bezahlt von